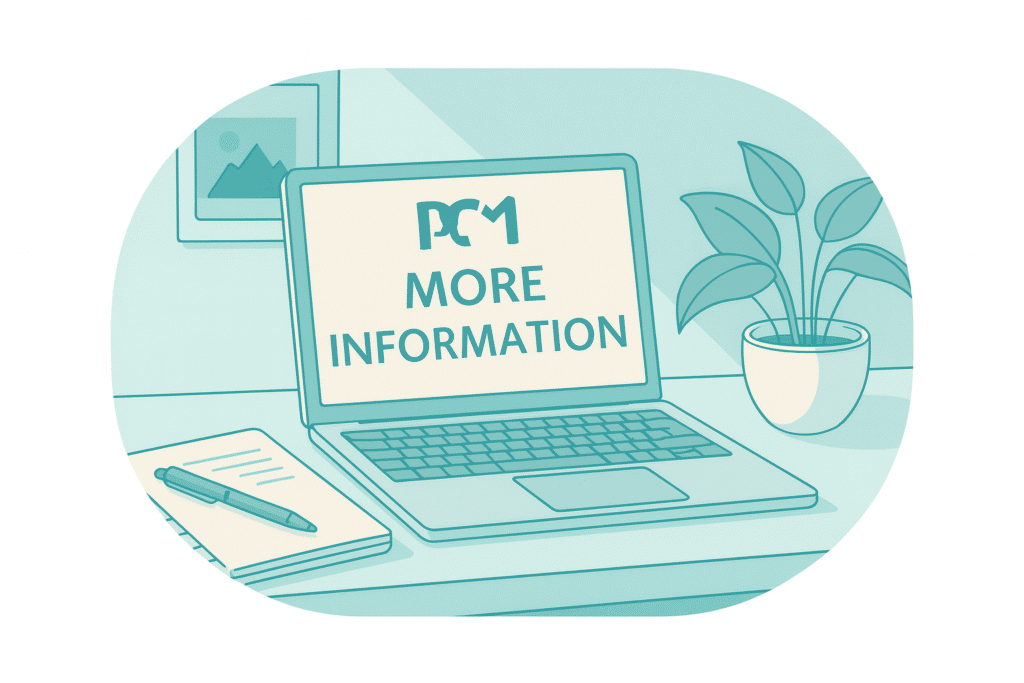SERIE Angststörungen: Entstehung & Aufrechterhaltung
Ab wann wird Angst zum Problem?
In der heutigen Lebenswelt überschreitet Angst häufig ihre Schutzfunktion und passt dadurch nicht mehr zur realen Gefahr. Sie richtet sich zunehmend gegen harmlose Objekte oder Alltagssituationen, sodass die Grenze zwischen Gefährdung und Normalität zunehmend verschwimmt. Ein nicht mehr angemessenes Angstgefühl entwickelt sich häufig schleichend und steigert sich im Verlauf, wodurch das Leben deutlich eingeschränkt wird.
Beispiel Thom
Tom fährt auf der Autobahn, wird von einem LKW geschnitten und erlebt starke Furcht. Einige Tage später spürt er bereits ein mulmiges Gefühl beim Gedanken ans Autofahren; beim nächsten Mal bleibt er aus Sicherheitsgründen nur rechts. Mit der Zeit wächst die Angst weiter, sodass Tom zunächst die Autobahn meidet und später das Autofahren generell vermeidet. Sein Leben ist dadurch spürbar eingeschränkt.
Psychologisch gesehen hat sich eine übertriebene Angst in Bezug auf das Autofahren erlernt, die sich anschließend immer weiter verfestigen kann.

Ab wann spricht man von einer Angststörung?
Von einer Angststörung spricht man dann, wenn Ängste ohne reale Bedrohung auftreten, unangemessen stark oder häufig sind, zu lange andauern und gleichzeitig mit ausgeprägten körperlichen Beschwerden einhergehen. Entscheidend ist daher, dass diese Symptome nicht mehr im Verhältnis zur tatsächlichen Situation stehen.
Wie entstehen Angststörungen?
Der „Teufelskreis der Angst“
Eine plötzlich auftretende, unkontrollierbare Angst mit körperlichen Symptomen wird als sehr unangenehm erlebt. Aus Angst vor der nächsten Attacke richtet sich die Aufmerksamkeit verstärkt auf Körpersignale. Diese Anspannung erhöht die physiologische Erregung, die wiederum als gefährlich gedeutet wird. Dadurch schaukelt sich der Kreislauf zunehmend auf und kann erneute Panikattacken auslösen.

Zwei-Faktoren-Theorie (Mowrer)
1) Angstentstehung – klassische Konditionierung
Ein ursprünglich neutraler Reiz wird – zusammen mit einem Schreckerlebnis – zum Auslöser von Angst.
Beispiel Michael:
Im Kaufhaus bekommt Michael Herzrasen und Panik. Fortan werden Kaufhäuser zu Angstauslösern – das zuvor neutrale Kaufhaus wird zum konditionierten Reiz. Dadurch reicht später bereits der Gedanke an ein Kaufhaus, um Angst auszulösen.
2) Angstaufrechterhaltung – operante Konditionierung
Vermeidung – also nicht mehr ins Kaufhaus zu gehen – verhindert korrigierende Erfahrungen wie „Es lag gar nicht am Kaufhaus“. Die Angst bleibt deshalb hoch oder steigt weiter.
Dieser Prozess generalisiert häufig auf weitere Situationen (Fußgängerzone, U-Bahn etc.), sodass sowohl das Privat- als auch das Berufsleben massiv beeinträchtigt werden.

Modell der emotionalen Verarbeitung & Sicherheitsverhalten
Auch wenn Situationen nicht vollständig vermieden werden, kann die emotionale Verarbeitung auf Gedanken-, Körper- und Handlungsebene ausbleiben – insbesondere dann, wenn Sicherheitsverhaltensweisen eingesetzt werden, zum Beispiel durch:
- wiederholtes Überprüfen (z. B. Körper-Checken)
- Sicherheitsgegenstände (Wasserflasche, Handy)
- Bestätigung suchen (beruhigende Rückfragen)
- mentale Rituale (Mantras, Gedankenformeln)
- Ablenkung (Zählen, Singen etc.)
Diese Strategien wirken kurzfristig beruhigend, langfristig jedoch verstärken sie die Angst und verhindern, dass korrigierende Erfahrungen entstehen (nach dem Motto „halb so wild“).
Kognitives Modell der sozialen Phobie
- Gedanken: Überschätzung fremder Aufmerksamkeit oder Bewertung
- Selbstfokus: Starke Wahrnehmung eigener Symptome (Zittern, Schwitzen), wodurch Unsicherheit steigt
- Vermeidung: Kurzfristige Entlastung, aber keine langfristige Verbesserung
- Nachgrübeln: Übermäßiges Nachbearbeiten sozialer Situationen
Das Zusammenspiel dieser Faktoren steigert die Angst, fördert Vermeidung und begünstigt eine Chronifizierung der Beschwerden.
Modell der somatischen Suppression
Das Unterdrücken körperlicher Empfindungen – wie Herzklopfen – führt paradoxerweise zu mehr Aufmerksamkeit und verstärkter Wahrnehmung. Dadurch entsteht ein Kreislauf aus Fokussierung und Angst.
Das Beispiel „Denken Sie nicht an einen rosa Elefanten“ zeigt gut, wie Unterdrückung oft das Gegenteil bewirkt. Ähnlich verhält es sich mit Gefühlen und Körpersensationen.
Multifaktorielles Modell der Angststörung
Angststörungen entstehen durch ein Zusammenspiel biologischer, psychologischer und umweltbezogener Faktoren.
Biologische Faktoren
Genetik, Neurobiologie (u. a. Amygdala, Hippocampus, präfrontaler Kortex) sowie Neurotransmitter wie Serotonin, Noradrenalin und GABA. Ungleichgewichte oder Dysfunktionen können die Angstanfälligkeit erhöhen.
Psychologische Faktoren
Denkmuster, Überzeugungen, Grübeln und eine erhöhte Bedrohungssensibilität.
Umweltfaktoren
Lebensereignisse, familiäre Dynamiken, kulturelle Einflüsse oder traumatische Erfahrungen.
Die Behandlung profitiert von einer ganzheitlichen Sicht und einer passgenauen Psychotherapie, die alle Ebenen berücksichtigt und sowohl kurzfristige Entlastung als auch langfristige Stabilisierung ermöglich